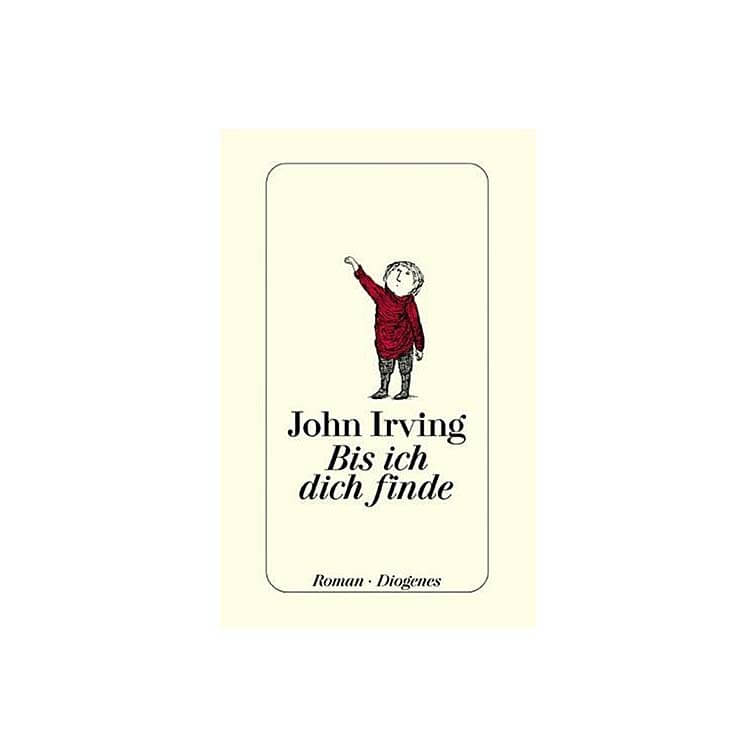John Irving: Das Hotel New Hampshire
John Irving ist ein Besteller-Autor: Mit „Garp und wie er die Welt sah“ und „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ hat er es sogar auf unsere TV-Bildschirme geschafft. Der Roman über die Familie, die vorwiegend ihr Leben in Hotels verbringt, ist das fünfte Buch des amerikanischen Autors, das ebenfalls verfilmt wurde. Die Geschichte erzählt von fünf Geschwistern und deren Eltern, von echten und weniger echten Bären, einem ausgestopften Hund, Baseball, Prostituierten und von Wien, wo die Berrys sieben Jahre in ihrem zweiten Hotel, dem „Gasthaus Freud“, verbringen. Irvings Geschichten sind so schräg, dass sie schon wieder Realität sein könnten: Hauptdarsteller des Romans ist die Berry-Familie, in der alle ihren eigenen Tick haben: der Vater versucht sich als Besitzer mehrerer Hotels und scheitert bei jedem seiner Projekte. Franny, die älteste Tochter, arbeitet eine Vergewaltigung auf. Frank, der älteste Sohn, ist schwul. Lilly, jüngste Berry-Tochter, hört in ihrer Kindheit auf zu wachsen. Egg, der jüngste, war immer schon ein Ei und schwerhörig. John, der zweitälteste Sohn und Ich-Erzähler, ist erst dann von seiner bedingungslosen Liebe zu seiner Schwester Franny geheilt, als er mit ihr eine Nacht durchvögelt.
Irving beschränkt sich aber nicht nur auf seine schrägen Hauptdarsteller. Jeder ausführlich skizzierte Charakter wird mit zumindest einer Macke ausgezeichnet. Diese oft wunderlichen Eigenheiten gipfeln im Auftritt eines motorradfahrenden Bären und eines toten Hundes, der auch ausgestopft auf seltsame Weise lebt.
Die Geschichte der Familie Berry beginnt Ende der 30er Jahre, als sich Vater und Mutter kennenlernen. Winslow und Mary verlieben sich während eines Ferienjobs im Hotel „Arbuthnot“, wo sie auch Freud (nicht der Freud), ein österreichischer Jude, der mit seinem dressierten und ziemlich dämlichen Bären „State o’Maine“ die Hotels abklappert, kennen. Freud und Winslows Liebe zu Hotels zwischen Maine, Wien und New York bestimmen fortan das Leben der Familie Berry.
„Dies ist ein Märchen“, schrieb Lilly später – über das ganze Leben unserer Familie. Ich stimme ihr zu; Iowa-Bob hätte ihr auch zugestimmt. „Alles ist ein Märchen!“ häte Coach Bob gesagt. Und selbst Freud hätte ihm zugestimmt – beide Freuds. Alles ist ein Märchen.“