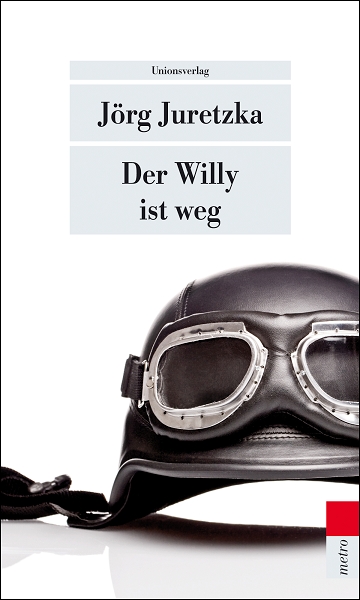
Jörg Juretzka: Der Willy ist weg
Dieses Buch wurde mir regelrecht in die Hand gedrückt, mit den lauthals lachenden Empfehlungen einer etwas älteren Inhaberin eines kleinen Buchgeschäfts. Was sie mir nicht gesagt hat, dass dieser Krimi bereits der dritte Band der Kristof Kryszinski-Reihe des deutschen Schriftsteller Jörg Juretzka ist. Was aber ziemlich egal ist: Über Vorleben und soziales Umfeld des Protagonisten und Ich-Erzählers bekommt man auch so noch genügend mit. Kristof Kryszinski ist Privatdetektiv und dass er ausgerechnet diese Tätigkeit ausübt, ist verwunderlich. Bis vor kurzem hat der Ex-Drogensüchtige selbst noch gesessen und verbüsst noch 14 Monate auf Bewährung. Hinzu kommt, dass er sich nicht gerade in einem moralisch und gesetzlich unbedenklichen Umfeld bewegt, denn Kristof ist Mitglied der Mühlheimer Bikergang „Stormfuckers“. Als seine Spezis (alle mit klingenden Namen wie „Poppel“, „Scuzzi“, „Hoho“ und „Schisser“) nach drei Tagen endlich bemerken, dass ihr Maskottchen Willy nicht mehr da ist und etwas später ein Erpressungsschreiben samt Polaroid eines übel zugerichteten Willy eintrifft, beginnt Kristof zu ermitteln. Madonna trällert „Like a Virgin“ und es wird noch in D-Mark gerechnet: In den Anfängen der Achziger waren Biker-Clubs modern, Alligator-Cowboy-Stiefel und Leder mit Fransen und Schnüre voll im Trend und Mc Donalds auf Expansionskurs. Soviel zur zeitlichen Dimension, in der sich die Geschichte bewegt. Der sympathische Hauptdarsteller Kristof ist seit einem Jahr gewerblich angemeldeter Detektiv und darauf spezialisiert, ins Drogenmilieu abgedriftete Sprösslinge reicher Eltern aufzutreiben und zurückzubringen. Gleichzeitig steht er bei einem Projektleiter einer amerikanischen Fast-Food-Kette (die mit dem „M“) unter Vertrag. In wenigen Tagen soll die Eröffnung der Filiale in Mühlheim sein und jemand sabotiert die Werbeträger der Firma. Und damit sich das Chaos so richtig entfalten kann, verschwindet auch noch der Willy. Willy ist das Club-Maskottchen der „Stormfuckers“, ein sogenannter „Hanger-on„. Vorerst macht sich Kristof aber noch keine Gedanken darüber, dass Willy nicht mehr da ist:
„Willy ging nicht, Willy taumelte durchs Leben. Mit den Füßen auf tückischem Untergrund und dem Kopf in den Wolken. Und dem Puls in der Hose. Willy hatte einen Sextrieb, mit dem man einen gestrandeten Öltanker freischleppen könnte. Wenn es ihn überkam, zog er los und kehrte nicht eher zurück, bis er irgendwen oder irgendwas aufgegabelt hatte. Egal wie, egal was.
„Er wird auf der Pirsch sein“, sagte ich, leichthin, mit anderem beschäftigt. „Wenn er bis heute Abend nicht zurück ist, ziehen wir mal um die Häuser und sehen nach ihm. So, ich muss los. Kann ich den Commo haben?“ Konnte ich.
Willy Heckhoff ist gutmütig und nicht gerade der hellste. Aber er ist Millionenerbe und Besitzer einer Villa, die den „Stormfuckers“ als ziemlich kostengünstiges Domizil dient. Als der Erpresserbrief auf dem Küchentisch liegt, sind die Stormfuckers schockiert. Drei Tage bleiben ihnen das Lösegeld in der Höhe von einer Million Mark aufzutreiben. Schneller als ihnen lieb ist, haben die „Stormfuckers“ im Zuge ihrer „kreativen Geldbeschaffung“ mit Neo-Nazis, der Mafia und einem unkooperativen Vermögensverwalter zu tun.
Jörg Juretzka hat schon mehrfach den Deutschen Krimipreis gewonnen, trägt den Beinamen „Ruhrpott-Chandler“ und ist bei seiner Fan-Gemeinde für seinen rotzig-frechen Stil beliebt. Er spielt mit den Klischees aus der Biker-Welt – klar, dass er dann auch ihre Sprache verwendet. Es könnte allerdings sein, dass Juretzka manchen Lesern zu derb ist. Einen Krimi in einer Kleinstadt anzusiedeln, die von territoriumsgeilen Wahnsinnigen beherrscht wird und wo eine kleine Truppe sympathischer Drogensüchtiger nach ihrem Maskottchen sucht, ist jedenfalls mal etwas anderes. Dem Autor ist es gelungen, seinen pointiert-derben und gar nicht trivialen Erzählstil bis zum Ende beizubehalten und mit seinen Sagern gut zu unterhalten.
Ende der Sechziger muss es gewesen sein, als jemand die oft wiederholte Behauptung aufgestellt hat, Drogen erweiterten das Bewusstsein, und wir haben seitdem immer noch nicht wieder aufgehört, darüber zu lachen.
Ich weiß nicht, was er in mir sah, aber das Gefühl gegenseitiger Abneigung schwängerte die Luft wie ein warmer Furz mit langer Standzeit.
Es gibt bequemere Standorte als zwanzig Meter über Grund auf halber Höhe eines Überland-Strommastes, die beiden zusätzlich noch ein schweres Nachtglas haltenden Arme um einen Eisenträger geschlungen wie um den Hals einer Geliebten, die Füße unsicher auf frostigen Leitersprossen und ganz allgemein leicht zittrig in einem stetigen, beständig und gleich mäßig Körperwärme abtransportierenden Nachtwind.
Im Hintergrund versuchte ein neckisch säuselnder Sänger einen Bruder Louielouielouie davon zu überzeugen, dass er zu nichts tauge.“