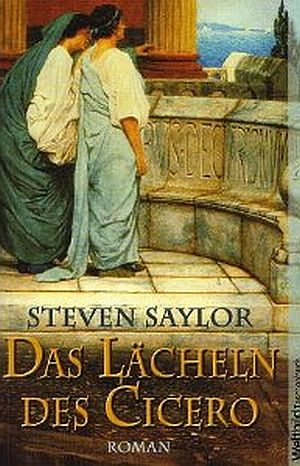
Steven Saylor: Das Lächeln des Ciceros
Serien-Krimis in Buchform haben einen entscheidenden Vorteil: Sie nerven nicht so wie ihre TV-Pendants. Vor allem, so kommt mir vor, weil die Produzenten sich doch mehr einfallen lassen und in einem Buch halt doch mehr verpackt werden kann als in 45 Minuten. Mit „Das Lächeln des Ciceros“ möchte ich eine Histo-Krimi-Reihe eines amerikanischen Schriftstellers vorstellen, der Geschichte so richtig studiert hat und als Experte für römische Geschichte gilt. Anfang der 90er erschien als Auftakt seiner Krimi-Reihe „Roma Sub Rosa“ (was soviel wie „Rom im Geheimen“ bedeutet) sein erster Roman „Ciceros Lächeln“. Mittlerweise gibt’s schon 12 Geschichten über den antiken Detektiv Gordianus, der im alten Rom zur Endzeit der Republik Greueltaten aufklärt. Zur Abwechslung also mal ein Krimi ohne moderne Forensik und High-Tech-Waffen. 80 vor Christus: Rom ist durch Korruption und Konflikte um die Landverteilung und das Bürgerrecht ein instabiles Pflaster. Lucius Cornelius Sulla herrscht als machtverliebter Diktator und führt Prostskriptionen (römische Bürger wurden mehr oder weniger willkürlich auf Kopfgeldlisten gesetzt; ihr Besitz fiel damit automatisch dem Staat zu) durch. Durch diese Enteignungen kamen Sullas Freunde ziemlich billig an viel Land, unter ihnen auch Sullas Ex-Sklave Chrysogonos. Durch die Ächtung von Sextus Roscius, einem römischen Bürger aus Ameria, kommt Chrysogonos um ein Spottgeld an dessen gesamten Besitz. Da aber die Zeit der offiziellen Prostskriptionen bereits vorbei ist, dichtet man Sextus Roscius noch den Mord an seinem Vater an. Kein Geringerer als der berühmte Politiker, Anwalt und Philosoph Marcus Tullius Cicero übernimmt die Verteidigung des Angeklagten.
Soweit die historischen Fakten.
Saylor hat den Komplott um Sextus Roscius als Vorlage für „Das Lächeln des Ciceros“ verwendet und ihm mit seinem eigentümlichen Helden Gordianus, den „Sucher“, aufgepeppt. In der Geschichte wird Gordianus von Cicero beauftragt, mehr über Sextus Roscius und über den angeblichen Vatermord heraus zu finden. Keine leichte Sache, wenn man bedenkt, dass Verrat und Spionage im alten Rom auf der Tagesordnung stehen und jeder nur alles Erdenkliche tut, um seine eigenen Interessen zu schützen. Doch Gordianus ist in den dunklen Gassen Roms nicht allein: Cicero stellt ihm seinen jungen Assistenten/Sklave Tiro (48–43 v.Chr.) zur Seite. Mit Köpfchen und viel körperlichen Einsatz gehen die beiden zur Sache.
Wie soll ich Marcus Tullius Cicero beschreiben? Die Schönen sehen alle gleich aus, aber ein häßlicher Mann ist auf ganz eigene Weise häßlich. Cicero hatte eine ausgeprägte Sitrn, eine fleischige Nase, und sein Haar lichtete sich. Er war mittelgroß mit einer schmächtigen Brust, schmalen Schultern und einem langen Hals mit kräftigem Adamsapfel. Er sah wesentlich älter aus als sechsundzwanzig.
„Gordianus“, stellte Tiro mich vor. „Den sie den Sucher nennen.“
Ich nickte. Cicero lächelte freundlich. In seinen Augen lag ein rastloses, neugieriges Funkeln. Ich war sofort beeindruckt, ohne recht zu wissen, warum.
Und im nächsten Augenblick entsetzt, als Cicero den Mund aufmachte, um zu sprechen. Er sagte nur zwei Worte, aber das reichte. Er hatte eine schrille, kratzende Stimme. Tiro mit seinen wohlklingenden Modulationen hätte der Redner sein sollen. Cicero hatte eine Stimme, die einem Auktionator oder Komiker gut gestanden hätte, eine Stimme so seltsam wie sein Name. „Hier entlang“, sagte er und macht er uns ein Zeichen, ihm durch den roten Vorhang zu folgen.
Der Flur war recht kurz, parktisch gar kein richtiger Flur. Wir gingen nur ein paar Schritte zwischen kargen Wänden entlang, bevor die Mauern abrupt endeten. rEchts von uns hing ein breiter Vorhang von blaßgelber Gaze, so fein, daß ich dahinter ein kleines, aber makellos gepflegtes Atrium erkennen konnte. Unter offenem Himmel und in der prallen Sonne wirkte das Atrium wie ein aus dem Haus herausgeschnittener Brunnen, ein Speicher, der vor Hitze und Licht überzuquellen schien. In der Mitte plätscherte ein kleiner Quell vor sich hin. Der Gazevorhang bauschte sich und wogte sanft wie ein Nebel im Wind, wie eine lebende Membran, die beim leichtesten Luftzug aufseufzt.
Steven Saylor gestaltet den historischen Krimi für den Leser in erster Linie spannend und ist auch für historische Nackerpatzln ansprechend zu lesen. Ohne sich in historische Details zu verlieben, skizziert er ein plastisches Bild des antiken Roms: Die Gestaltung der Häuser, der Gassen, die Beschreibung des Alltags in der Metropole und im Gegensatz dazu die Schilderungen über die ländliche Lebensweise etc. So lebendig könnte Geschichte sein…
So nett der Roman aber ist, leider ist da doch ein winzig-kleines Haar in der Suppe, von dem ich nicht weiß, ob es der Autor oder der Übesetzer hineinfallen hat lassen: So authentisch der Roman auch ist – in dieser Zeit hat es mit Sicherheit keine „Babys“ gegeben.