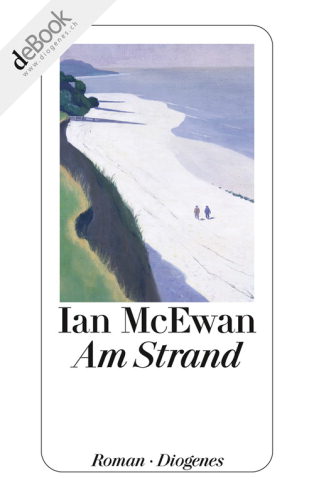Edward und Florence haben soeben geheiratet und verbringen ihre Flitterwochen in einem kleinen Hotel an einem Strand in Dorset. Beim gemeinsamen Abendessen, das sie Florence zuliebe auf dem Zimmer einnehmen, ist bereits die erste Nervosität der beiden zu spüren. Es ist die bevorstehende Hochzeitsnacht, die die beiden unruhig macht. Florence kennt Sex nur aus dem Lehrbuch und schon allein das Wort „Penetration“ versursacht ihr Übelkeit. Edward hingegen will diese Nacht keinesfalls vermasseln und setzt sich wegen einer „Ejaculatio praecox“ unter Druck. Die Situation ist angespannt – nicht nur deshalb, weil man das Jahr 1962 schreibt und noch weit entfernt von jeglicher sexueller Aufklärung ist. Ein zwischenmenschliches Dilemma, prägnant und fesselnd erzählt. Die vertrackte Situation, die sich dem Leser dann in der Hotelsuite darbietet, resultiert nicht zuletzt durch den soziokulturellen Umgang mit Sex und Erotik in den 60ern. Die sexuelle Revolution hat noch nicht stattgefunden: Florence und Edward haben nie gelernt, über Gefühle, die über das Standardrepertoire der damaligen Zeit hinaus gehen (z.B. „Ich liebe dich“) körperlich auszudrücken und sprachlich zu artikulieren. Unwissenheit über den eigenen Körper und das andere Geschlecht macht es unmöglich, die ersehnte Freiheit, die sich beide für ihre Beziehung wünschen, zu erlangen.
Der zweite Aspekt der Geschichte sind die unterschiedlichen familiären Verhältnisse, aus denen die beiden kommen. Florence stammt aus einer bürgerlichen und gut situierten Familie, hat jedoch von ihren Eltern nie körperlichen Kontakt erfahren und ist somit auch mit Zärtlichkeiten nicht vertraut. Edwards Vater hingegen ist Lehrer, der mehr oder weniger allein für seinen Sohn und seine beiden Töchter sorgen muss. Edwards Mutter ist durch einen Unfall „gehirngeschädigt“, was schlussendlich bedeutet, dass sie keinen Beitrag für Familie und Haushalt leisten kann. Aber man bekommt das Gefühl, dass Edward unter dem Dach dieses kleinen, schäbigen und verschmutzten Landhäuschens mehr Zuneigung von Vater und Schwestern bekommt als Florence.
Florence erhofft sich durch die Heirat mit Edward, sich von ihrem Elternhaus (besonders von der Mutter) zu lösen, bei Edward ist es ähnlich. Beide glauben, durch ihre Verbindung miteinander frei zu sein.
Und was stand ihnen im Weg? Ihr Charakter und ihre Vergangenheit, Unwissen und Furcht, Schüchternheit und Prüderie, innere Verbote, mangelnde Erfahrung oder fehlende Lockerheit, und dann noch der Rattenschwanz religiöser Verbote, ihre englische Herkunft, ihre Klassenzugehörigkeit und die Geschichte selbst. Also nicht gerade wenig.“
McEwan konzentriert seine Erzählung auf eine Nacht – es sollte die erste Nacht eines frisch verheirateten Paares sein – und lässt die beiden Protagonisten darüber nachdenken, wie sie sich kennen gelernt haben, wie sich die ersten Verabredungen gestalteten, was sie füreinander empfinden, warum sie ineinander verliebt sind und auch wie sie sich ihre (gemeinsame) Zukunft vorstellen. McEwan gilt als Meister der Charakterstudien und wird auch in diesem kurz gehaltenen Roman seinem Ruf gerecht. Detailliert (aber nicht langatmig oder -weilig!) erzählt er von einer kurzen Zeitspanne im Leben zweier Menschen, die am Fehlen einer gemeinsamen Sprache hoffnungslos scheitern.
Sie griff mit Daumen und Zeigefinger nach seinem Ohrläppchen, zog seinen Kopf sanft zu sich herab und flüsterte: „Ehrlich gesagt, ich hab ein bißchen Angst.“
Strenggenommen war das nicht ganz korrekt, aber sosehr sie auch nachdachte, sie hätte die Vielzahl ihrer Emfpindungen doch nie beschreiben können: ein mulmiges Gefühl, als würde sie innerlich vertrocknen und schrumpfen, ein unbestimmter Widerwille gegen das, was ihr womöglich abverlangt werden würde, sowie Scham bei dem Gedanken, ihn zu enttäuschen und als Betrügerin entlarvt zu werden. Sie konnte sich selbst nicht leiden, und noch während sie ihm ins Ohr flüsterte, war ihr, als spielten sie Theater und ein Bösewicht zischte ihr die Worte zu. Immerhin war es besser zu behaupten, sie fürchtete sich, als ihm ihre Scham oder ihren Ekel zu gestehen. Sie mußte versuchen, seine Erwartungen möglichst zu dämpfen.
Er schaute sie an, doch verriet nichts an seiner Miene, daß er sie gehört hatte. Selbst in ihrer vertrackten Lage staunte sie über seine sanft blickenden, braunen Augen. Welch verständnisvolle Klugheit. Wenn sie sich in seinen Blick versenkte und sonst nichts sah, könnte sie vielleicht tun, worum er sie bitten würde. Sie wollte ihm bedinungslos vertrauen. Doch das war bloßes Wunschdenken.
Endlich erwiderte er: „Ich glaub, ich auch“, doch während er das sagte, legte er ihr eine Hand direkt übers Knie, ließ sie unter den Kleidersaum gleiten und drang auf der Innenseite ihres Schenkels nach oben vor, bis sein Daumen das Höschen berührte.